Kann man da eine Faustregel draus ableiten? Sprich wenn die Kapazität bei 100 KHz oberhalb von (sagen wir mal) 50% der Nennkapazität ist, wäre der dann filtertechnisch auch noch gut? Oder anders gesagt: Kann man von der Kapazitätsmessung bei 100 KHz ableiten, wie es innerlich um die Filterung bestellt ist?
Nicht wirklich, zumindest nicht in einer Art, die irgendwie allgemeingültig anzuwenden wäre.
Da sind ja mehrere Faktoren im Spiel, die jeweils verschiedene Charakteristiken beeinflussen und selbst wenn man das alles berücksichtigt, bleibt ja immer noch die konstruktive Gesamtauslegung des Kondensators selbst, die von Serie zu Serie oder selbst innerhalb der Serien je nach Spannungsfestigkeit unterschiedlich sein kann.
Dazu ist das Verhalten / die Auswirkung je nach Frequenzbereich unterschiedlich.
Betrachten wir die
tiefen Frequenzen, z.B. bei 120 Hz, ist die
Kapazität des Kondensators der dominante Wirkungsanteil des Kondensators. Nehmen wir mal an, du hast einen 100µF Kondensator mit einer Impedanz von 10 Ohm, dann würde sich bei 50% Verlust der Kapazität auf 50µF die Impedanz auf 20 Ohm verdoppeln, gleichzeitig würde sich der Ripple Anteil ungefähr verdoppeln (alles sehr vereinfacht dargestellt). Dazu gibt es Nebeneffekte, wie ggf. ansteigender Leckstrom, etc. aber bei tiefen Frequenzen dominiert die Kapazität die Wirkung des Kondensators.
Bei
hohen Frequenzen sieht das dann etwas anders aus. Hier ist der
ESR dominanter, denn mit steigendem ESR steigt auch die minimale Impedanz des Kondensators, wodurch wiederum seine Fähigkeit eingeschränkt wird, HF-Störungen zu filtern / zu dämpfen. Er soll ja im Idealfall die hochfrequenten Störungen direkt gegen Masse ableiten damit die sich eben nicht in die nachgelagerte Versorgung "verteilen". Damit das überhaupt geht, muss die Impedanz an der Störquelle, z.B. einem FET, richtig klein sein, damit der Anteil durch den Kondensator abgeleitet wird und nicht andere Wege einschlägt.
Also was passiert ist ja, dass Störspannungen durch den Schaltvorgang entstehen, manchmal auch einfach "Schaltgeräusche" genannt. Je höher die Frequenz, umso ausgeprägter i.d.R. der Effekt. Stell dir vor, du hast ein FET, welches beim Schaltvorgang einen Stromimpuls erzeugt, z.B. sagen wir mal 1500mA. Jetzt haben wir da einen verkorksten Kondensator sitzen, der einen ESR von nur noch sagen wir 0,2 Ohm hat, dann ergeben sich daraus alleine schon 300mV Störspannung, die auf der Versorgungsspannung aufliegen, denn der Strom fließt nicht einfach ohne Spannung durch, sondern fällt über den ESR ab, unser Serienwiderstand. Zeitgleich steigt die Hitzentwicklung im Kondensator, da die Energie durch den Widerstand teilweise in Wärme umgewandelt wird.
Hast du jetzt aber einen Kondensator da stehen mit sagen wir 0,012 Ohm, also ESR12, dann ergibt sich daraus eine theoretische Störspannung von 18mV, die auf der Versorgung "liegen" bleibt, der restliche Anteil wird gegen Masse abgeleitet. Je höher nun unsere Impulse sind, umso krasser der Effekt.
Deswegen ist, wenn wir Ultra-Low-ESR betrachten, der ESR erstmal eine der allerwichtigsten Größen, wenn es darum geht den Ripple Anteil zu reduzieren und eine gute HF Filterung zu ermöglichen.
Wie ich es schon oft geschrieben habe, ist daher in vielen Fällen die hohe Kapazität z.B. unserer typischen 6,3/3300µF Kondensatoren ein durch die Art des Kondensators bedingtes "Nebenprodukt", welches aber nicht primär zur Beurteilung der Filterleistung in hohen Kapazitäten herangezogen werden kann und ein Grund, warum wir oftmals problemlos auch 1500µF oder 2200µF Polys setzen können und die Filterleistung trotzdem verbessern, da hier der geringe ESR der Polys einen viel größeren Eintrag hat in die Restwelligkeit als alles andere. Natürlich darf man die Kapazität nicht grundsätzlich vernachlässigen, denn ab einer bestimmten Untergrenze kann je nach Lastzustand die Schaltung instabil werden, aber in Bezug auf die "Sauberkeit" unserer Signale durch HF Störungen, ist die Kapazität längst nicht so wichtig wie der ESR.
Um den Bogen zu deiner Frage zurück zu bekommen....
natürlich kann man durch eine Kapazitätsmessung bei 100 KHz schon sehen, ob der Kondensator ansich vielleicht schon stark degeneriert ist, wenn die effektive Kapazität in absurd niedrige Bereiche rückt. Natürlich wirst du bei 100 KHz nie die volle Kapazität aus dem Datenblatt sehen, sondern nur einen Teil davon, bedingt durch den ESR. Deswegen haben wir auf Mainboard im VRM Bereichen ja auch oft so viele dieser Bomben stehen, zum einen um den ESR weiter zu senken, zum anderen um auch bei hohen Frequenzen trotzdem eine bestimmte Kapazität zu erlangen, die für den Betrieb erforderlich ist.
Das alleine ist nun aber keine verlässliche Einschätzung ob der Kondensator noch eine gute Filterung bietet, denn wie oben geschrieben ist dafür bei hohen Frequenzen in erster Linie der ESR einer unserer wichtigsten Anhaltspunkte. Natürlich kann durch Alterung die Kapazität auch ins bodenlose sinken, aber wenn der ESR schon nicht passt, ist die Betrachtung der Kapazität nachrangig und trotzdem nichts sagend.
Viel wichtiger in der Betrachtung, nach dem ESR aber noch vor der Kapazität, ist eher der Verlustfaktor des Kondensators, denn auch der kann durch Alterung entsprechend größer werden, sodass mehr Energie in Wärme verwandelt wird, statt sie effektiv gegen Masse abzuleiten, was wiederum ebenfalls eine drastische Verschlechterung des HF Filterverhaltens mit sich bringt. Da reicht dann schon eine Änderung des Verlustfaktors von z.B. 2% auf 8% und du hast direkt eine 4x schlechtere HF Dämpfung und mehr Wärmeverluste. Als
zusätzlichen Eintrag zur ESR Verschlechterung wohlgemerkt.
Hinzu kommt, dass sich das Impedanzverhalten eines Kondensators über den Frequenzverlauf dramatisch ändern kann. Ich habe da mal schnell was gebastelt:
Das ist jetzt mal eine beispielhafte Darstellung, wie ein Impedanzsweep bei einem Kondensator aussehen kann in verschiedenen Zuständen / Varianten:
rot und
grün sind zwei Beispiele für typische Kondensatorenverläufe über das Frequenzspektrum, mit einem erhöhten ESR im LF Bereich, einem Sweetspot irgendwie im 100-500 KHz Bereich und einem langsamen Anstieg hinten raus.
pink ist ein Beispiel dafür, wie sich ein stark degenerierter Ultra-Low-ESR Kondensator verhalten kann. Du hast einen relativ geringen ESR im LF Bereich, was z.B. typisch ist für hydroxidenthemmte Kondensatoren, aber durch eben diese Veränderung im Dielektrikum oder im Aluminium Foliensystem (Löcher, Heissstellen, reduzierte Leitfähigkeit an Heissstellen durch Reduktion des Nasskontakts etc.) verändert sich das Grundverhalten des Kondensators z.B. in höheren Frequenzen, sodass bei einem Test mit 1 KHz oder vllt. 10 KHz, die Welt manchmal noch nicht so schlecht aussieht, aber bei 100+ KHz kannst du plötzlich einen starken Anstieg des ESRs sehen. Das muss nicht zwingend schon bei 100 KHz erfolgen, kann auch sein, dass es erst bei 250+ sichtbar wird, aber als Beispiel sollte das dienen um zu verstehen, dass sich je nach Frequenzverlauf und Art / Zustand des Kondensators ein ganz anderes Bild ergeben kann.
blau ist ein Beispiel dafür, wie der
rote Kuvenverlauf (eines frischen, intakten Elkos) aussehen könnte, wenn wir eine Serie einsetzen, die nur bedingt für den Einsatz in HF Szenarien konzipiert wurde. Oftmals sind das Typen, die bspw. für eine lange Haltbarkeit unter Standardanwendungen konzipiert wurden im Bereich bis etwa 100 KHz, aber bei allem was darüber hinaus geht, verändert sich das Verhalten des Kondensators teilweise deutlich und das ist dann
nicht einer Degeneration geschuldet, sondern einfach dem Umstand, dass er konstruktionsmäßig anders entworfen wurde.
Das ist mein beliebtes Beispiel dafür, wenn ich manchmal sage, dass man hin und wieder – je nach Anwendung / Einsatzort / Gruppenkonstellation – aufpassen muss, welche Serie man mit welcher Serie ersetzt, denn zwischen den einzelnen Serien gibt es tlw. deutliche Unterschiede in ihrer Performance, je nach dem über welchen Anwendungszweck man spricht und gerade wenn wir von HF Anwendungen reden und zur optimalen Filterung auf einen geringen ESR angewiesen sind, ist es manchmal einfach kontraproduktiv, wenn wir z.B. wissen wir haben eine 500 KHz Schaltung vor uns und setzen dort eine Kondensatorserie, die sich in diesem Frequenzbereich schon deutlich außerhalb ihres Sweetspots befindet und ggf. schon einen ordentlichen Zuwachs in der Impedanz und in Folge im ESR sieht. Wenn wir dann nicht das "Glück" haben, dass diese suboptimale Serie eh in einem Cluster aus 3,4,5,6+ Kondensatoren parallel steht und der Umstand dadurch etwas entschärft wird, können sich auch mal ungewünschte Effekte einstellen.
Deswegen sage ich halt gerne, das normale Datenblatt ist zwar schön und gut, es gibt uns einen groben Anhaltspunkt bei den üblichen zwei Frequenzbereichen von 120 Hz und 100 KHz, aber man darf nicht vergessen, dass sich gerade in den Rändern der Frequenzbereiche deutlichere Unterschiede auftun als man denkt und man somit für manche Ersetzungen manchmal besser auf Serie X statt Serie Y zurückgreifen sollte, einfach weil diese eher zum Einsatzszenario passt. Die Hersteller haben ja viel mehr als nur die Standard Datenblätter und es gibt tonnenweise Material, relevant für Engineering / Applikationsdesign etc., wo genau solche Charakteristiken der einzelnen Serien beleuchtet werden. Ist oftmals halt sehr viel Recherche, aber je nach Anwendung kann das schonmal sinnvoll sein.
Also abschließend... Faustregel?
Wie gesagt, nicht wirklich. In HF Anwendungen kannst du das über die Kapazität nicht ausreichend bestimmen, da du eh nicht die volle Kapazität sehen wirst und du die effektive Kapazität bei Frequenz X nur schlecht einschätzen kannst zum "Sollzustand", außer natürlich es sind, wie oben geschrieben, wirklich bereits absolut absurde Werte. Ansonsten musst du für jede Form von HF Anwendungen in erster Linie ESR und Verlustfaktor betrachten und hast dann eine grobe Momentaufnahme dessen, wie der Kondensator zurecht sein könnte. Das heißt aber
nicht, dass seine Funktion "In-Place" in der Schaltung dennoch gut sein muss, denn wie in der Grafik aufgezeigt, kannst du bis zu einem gewissen Frequenzbereich durchaus auch dann "plausible" Werte erhalten, wenn du z.B bis 100 KHz messen kannst, aber wenn der Kondensator in der Schaltung die doppelte oder dreifache Frequenz sieht, kann er trotzdem völlig aufgeben und keine effektive Filterung mehr gewährleisten. Um das halt in solchen Szenarien prüfen zu können, brauchst du entweder ganz anderes Messequipment für weit oberhalb 100 KHz (wenn wir z.B. von CPU VRM Bereichen reden) oder du musst dir halt die betreffenden Kandidaten in der Schaltung am Oszi genau anschauen und in Relation zu einem frischen Kondensator, passend für das Einsatzszenario, setzen.
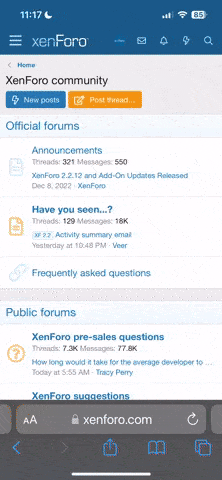


 Gut, ich schätze, das heißt, ich hab noch 16 funktionsfähige Speicher auf Halde
Gut, ich schätze, das heißt, ich hab noch 16 funktionsfähige Speicher auf Halde 







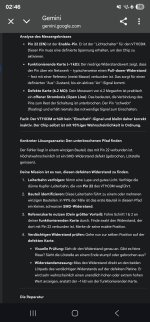
 - gibt genug Beispiele wo mit "Ai" mal gar nix funktioniert - totaler Slop-Generator mit viel zu hohem Fehleranteil - weil die einfach mal eiskalt das Web scanned inklusive dem Junk und nicht in der Lage Fehler zu trennen/erkennen [deswegen wollen die auch nicht rausrücken woher die ihre Quellen haben, wegen möglicher Klagen, copyright, geklaute Arbeit von anderen und so ]
- gibt genug Beispiele wo mit "Ai" mal gar nix funktioniert - totaler Slop-Generator mit viel zu hohem Fehleranteil - weil die einfach mal eiskalt das Web scanned inklusive dem Junk und nicht in der Lage Fehler zu trennen/erkennen [deswegen wollen die auch nicht rausrücken woher die ihre Quellen haben, wegen möglicher Klagen, copyright, geklaute Arbeit von anderen und so ]


