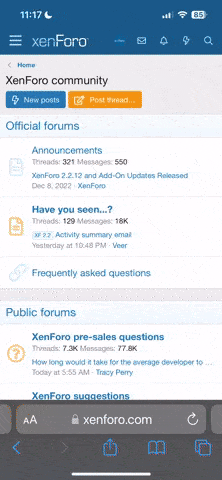Sehr gut — danke für die Präzisierung. Ich erkläre erst kurz das Modell, dann zeige ich ein
konkretes, einfaches Rechenbeispiel (keine Messdaten, sondern ein physikalisch plausibles Modell mit klaren Annahmen) und schließe mit der
Interpretation: welche Kennlinien sich verändern und
warum das zu weniger bzw. mehr Verwirbelung führt.
1) Modell / Grundgleichungen (kurz & präzise)
Wir nutzen zwei Grundbausteine:
a) Lüfterkennlinie (vereinfachte Form)
Für einen einzelnen Lüfter nehme ich eine typische Parabelform:
pfan(Q)=p0(1−(QQmax)2)p_{\text{fan}}(Q)=p_0\Big(1-\Big(\frac{Q}{Q_\text{max}}\Big)^2\Big)pfan(Q)=p0(1−(QmaxQ)2)
Das ist eine oft verwendete Näherung: bei Q=0Q=0Q=0 liefert der Lüfter den „blockierten“ Druck p0p_0p0, bei Q=QmaxQ=Q_\text{max}Q=Qmax fällt der Druck auf 0.
Für NNN identische Lüfter nebeneinander (parallel) gilt bei gegebener statischer Druckhöhe ppp:
Qtotal(p)=N⋅Qeinz(p)Q_{\text{total}}(p)=N\cdot Q_{\text{einz}}(p)Qtotal(p)=N⋅Qeinz(p)
und umgekehrt pfans(Qtotal)=pfan(Qtotal/N)p_{\text{fans}}(Q_{\text{total}})=p_{\text{fan}}(Q_{\text{total}}/N)pfans(Qtotal)=pfan(Qtotal/N).
b) Systemkennlinie (Druckverlust durch Radiator + Kanal)
Für turbulent geprägte lamellenartige Wärmetauscher ist die vereinfachte Form
Δp≈ζ 12ρ v2mit v=QA\Delta p \approx \zeta\;\tfrac{1}{2}\rho\;v^2\qquad\text{mit }v=\frac{Q}{A}Δp≈ζ21ρv2mit v=AQ
üblich. ζ\zetaζ ist ein effektiver Widerstandsbeiwert, der alle Verluste (Lamellenwiderstand, Eintritts-/Austrittsverluste, Ecken, Spalte, Ablösungen) zusammenfasst. Wichtig: Δp∝(Q/A)2\Delta p\propto (Q/A)^2Δp∝(Q/A)2.
2) Was sich bei „Plenum“ vs. „vollständiger Abschottung“ physikalisch ändert
- Effektive Einlauffläche AAA: Im Plenum kann sich die Strömung verteilen → die wirksame Querschnittsfläche, über die Luft in den Lamellen eintritt, ist „glatter“ nutzbar. Bei Abschottung existieren zwar nominell dieselben Flächen, aber lokale Störungen (Ecken, Übergänge) reduzieren die effektiv nutzbare Fläche und erzeugen lokale Engstellen/Separationsgebiete.
- Widerstandsbeiwerte ζ\zetaζ: Plenum → kleineres ζ\zetaζ. Abschottung → größeres ζ\zetaζ wegen zusätzlicher Eintritts-/Austrittsverluste, scharfen Kanten, Ablösungen in engen Kanälen.
- Schergradienten / Geschwindigkeitsprofile: Im Plenum mischen sich die Strahlen der Lüfter, hohe lokale Geschwindigkeitsgradienten werden über ein größeres Volumen verteilt → geringere lokale Scher → weniger Turbulenzerzeugung. In abgeschotteten Kanälen treten scharfe Geschwindigkeitswechsel an den Kanalrändern auf → hohe Scher → mehr lokale Turbulenz / Wirbel.
Kurz: Plenum → größere „beruhigte“ Volumenströme, kleinere lokale Gradienten → geringere Turbulenzintensität; Abschottung → schärfere Übergänge, höhere lokale Verluste und stärkere Wirbel.
3) Numerisches Beispiel (vereinfachte Zahlen, um die Kennlinienverschiebung zu zeigen)
Annahmen (Beispiel):
- Luftdichte ρ=1.2 kg/m3\rho=1{.}2\ \mathrm{kg/m^3}ρ=1.2 kg/m3.
- Ein Lüfter (Beispielkennlinie): p0=100 Pap_0=100\ \mathrm{Pa}p0=100 Pa, Qmax=0.1 m3/sQ_\text{max}=0{.}1\ \mathrm{m^3/s}Qmax=0.1 m3/s.
- Drei identische 120-mm-Lüfter (N=3). Querschnitt pro Lüfter A1=π⋅0.062≈0.0113 m2A_1=\pi\cdot0{.}06^2\approx0{.}0113\ \mathrm{m^2}A1=π⋅0.062≈0.0113 m2, Gesamt A3=3A1A_3=3A_1A3=3A1.
- Effektiver Widerstandsbeiwert:
- Plenum: ζplenum=2.0\zeta_{\text{plenum}}=2.0ζplenum=2.0 (relativ moderat)
- Abschottung: ζsep=4.0\zeta_{\text{sep}}=4.0ζsep=4.0 (höher durch Ecken/Entrances/Abflussverluste)
Mit diesen Annahmen findet man für den Betriebspunkt (Luftstrom QQQ bei dem Lüfter- und Systemdruck gleich sind):
- Plenum (10 mm Abstand, ζ=2\zeta=2ζ=2) → Betriebspunkt Qtot≈0.215 m3/sQ_{\text{tot}}\approx 0{.}215\ \mathrm{m^3/s}Qtot≈0.215 m3/s, p≈48 Pap\approx 48\ \mathrm{Pa}p≈48 Pa.
- Abschottung (ζ=4\zeta=4ζ=4) → Betriebspunkt Qtot≈0.177 m3/sQ_{\text{tot}}\approx 0{.}177\ \mathrm{m^3/s}Qtot≈0.177 m3/s, p≈65 Pap\approx 65\ \mathrm{Pa}p≈65 Pa.
Interpretation der Zahlen:
- Im Plenum liefert das Lüfter-Array größeren Durchsatz bei niedrigerer statischer Druckhöhe.
- In der abgeschotteten Variante steigt die erforderliche Druckhöhe (weil die Verluste zunehmen) und der erreichbare Durchsatz sinkt.
(Die konkreten Zahlen hängen stark von den Annahmen ab — Wahl von p0,Qmaxp_0,Q_\text{max}p0,Qmax und ζ\zetaζ — zeigen aber deutlich die Richtung des Effekts.)
4) Warum reduziert das Plenum die Verwirbelung konkret? (physikalische Mechanismen)
- Verteilung / Diffusion des Dralls: Lüfter erzeugen Rotationsanteile (Drall). In einem kleinen Plenum hat die Strömung Raum, diese Drallanteile teilweise durch Scher und Wirbelaufspaltung zu dissipieren, bevor sie auf die Lamellen treffen. Dadurch wird die Anströmung homogener.
- Reduktion von lokalen Schergradienten: Turbulenzerzeugung skaliert mit Scher → hohe ∂u/∂y\partial u/\partial y∂u/∂y erzeugen mehr Turbulenzkinetische Energie. Ein größeres Querschnitts-„Puffer“-Volumen reduziert diese Gradienten.
- Vermeidung von scharfen Eintrittsverhältnissen: Abschottungen erzeugen oft abrupt wechselnde Geometrien (Ecken, Kanten), an denen Strömung abrißt und starke Wirbel entstehen. Plenum → glattere Eintrittsverhältnisse.
- Druckausgleich zwischen Nachbarzonen: Kleine Druckunterschiede zwischen Lüfterzonen werden im Plenum ausgeglichen; ohne Plenum können lokale Über-/Unterdrücke Strömungsumlenkungen und Rückströmungen hervorrufen.
Mathematisch hängt die Turbulenzproduktion z. B. in einem RANS-Ansatz von Termen wie νt(∂ui/∂xj)2\nu_t (\partial u_i/\partial x_j)^2νt(∂ui/∂xj)2 ab — große Gradienten → viel Erzeugung. Plenum senkt die Gradienten → senkt Produktion.
5) Änderung der Kennlinien (p–Q) im Überblick
- Fan-Kurve bleibt (nahezu) dieselbe für die einzelnen Lüfter.
- System-Kurve (Radiator + Eintrittsverluste) ändert sich: für Plenum ist sie flacher (niedriger ζ\zetaζ), für Abschottung steiler (höherer ζ\zetaζ).
- Der Betriebspunkt verschiebt sich entlang der Fan-Kurve: Plenum → höherer Q, niedrigerer p; Abschottung → niedrigerer Q, höherer p.
- Zusätzlich: Abschottung kann lokale Strömungsinstabilitäten erzeugen, die effektiv zusätzliche „nichtlineare“ Verluste einbringen (d. h. die Systemkurve kann sogar weniger glatt und mit starken lokalen Abweichungen werden).
Graphisch: Fan-Kurve (nach unten offen Parabel) und zwei Systemkurven (Plenum flacher, Abschottung steiler); Schnittpunkte verschoben wie oben numerisch gezeigt.
6) Praktische Konsequenzen & Empfehlungen
- Wenn Ziel ist maximale Durchsatz-/Kühlleistung + homogene Lamellenanströmung → Plenum / Shroud ist in der Regel besser.
- Vollständige luftdichte Abschottung bringt nur Vorteile in speziellen Fällen: stark unterschiedliche Lüfterkennlinien, gewünschte Kanaltrennung (z. B. separater Luftpfad mit Temperaturunterschieden) oder wenn man Strömungen gezielt in Kanäle lenken will — aber typischerweise auf Kosten höherer lokal erzeugter Wirbel und schlechterer Homogenität.
- Für 360er mit 3×120 mm und 10 mm Abstand ist das Plenum praktisch und effektiv: es glättet Strömung, reduziert Scher und sorgt für höheren Gesamtdurchsatz.